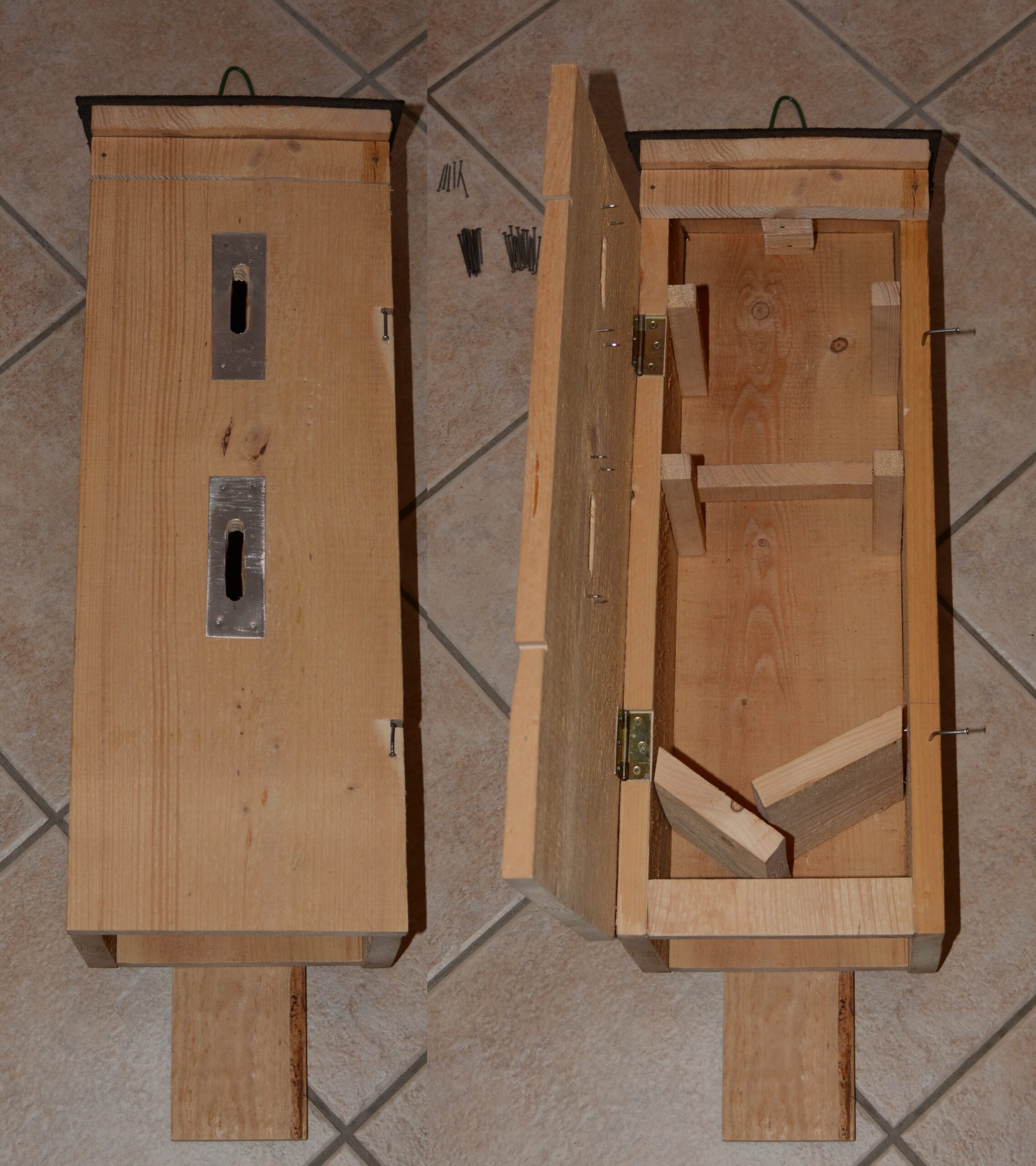Als ich vor Jahren mit meinem Waldumbau anfing, gab es eine klare Anbauempfehlung für die Rotbuche. Ich sollte in meinem Kiefernwald die Rotbuche unterpflanzen und auf die Jäger einwirken, den Abschuss zu erhöhen. Dann könnte sich die Eiche naturverjüngen und es entstünde ein Buche-Eichen-Kiefern-Mischwald.
Die letzten heißen, trockenen Jahre führten vermehrt zu Schäden an der Rotbuche, sodass man für die Rotbuche nun keine uneingeschränkte Anbauempfehlung mehr gibt. Nicht nur das. Von Seiten der Forstfachleute gibt es für keine einzige Baumart eine uneingeschränkte Anbauempfehlung. Stattdessen gibt es eine Risikoeinschätzung für jede Baumart und man betont die Entscheidungshoheit des Waldbesitzers – was ja nichts Schlechtes ist.
Die jetzt vorgestellten „Leitlinien für die Baumartenwahl im Klimawandel“ der Bayerischen Forstverwaltung beschreiben allgemeine Grundsätze. Den einheimischen Baumarten wird der Vorzug geben, wobei eher seltene heimische Arten gestärkt werden sollen (z. B. Elsbeere und Edelkastanie). In einem weiteren Schritt soll der Waldbesitzer auf heimische Baumarten aus wärmere Regionen Europas setzen und zu guter Letzt auch alternative Baumarten aus fremden Ländern in Betracht ziehen.
Die alternativen Baumarten unterteilt man in vier Eignungskategorien von „für den forstlichen Anbau geeignet“ (z. B. Robinie, Roteiche und Douglasie) bis „für den forstlichen Anbau ungeeignet“ (z. B. Strandkiefer und Blauglockenbaum).
Die Atlaszeder gehört wie die Baumhasel zu den alternativen Baumarten der Kategorie „eingeschränkte Anbauempfehlung, insbesondere in Form von Praxisanbauversuchen“. Es liegen bereits erste Erfahrungen vor und die Art lässt eine Eignung für das zukünftige Klima vermuten. Dabei geht es neben der Trockenresistenz auch um die Frostunempfindlichkeit. Allerdings sind Anbaurisiken (noch) nicht bekannt.
Vor einigen Tagen hatte ich die Möglichkeit eine Versuchsfläche mit Atlaszedern zu besuchen. Die Bäumchen wurden vor 5 Jahren auf einer eingezäunten Freifläche gepflanzt und haben in der Zwischenzeit die 2 Metergrenze erreicht. Beeindruckt hat mich die augenscheinliche Vitalität und der gerade Wuchs der Atlaszeder. Da die Atlaszeder angeblich auch mit Sandboden zurecht kommt, werde ich sicherlich auch einen Versuch starten.

Atlaszeder auf einer Versuchsfläche.
Hier gibt es weitere Informationen zur Leitlinie.