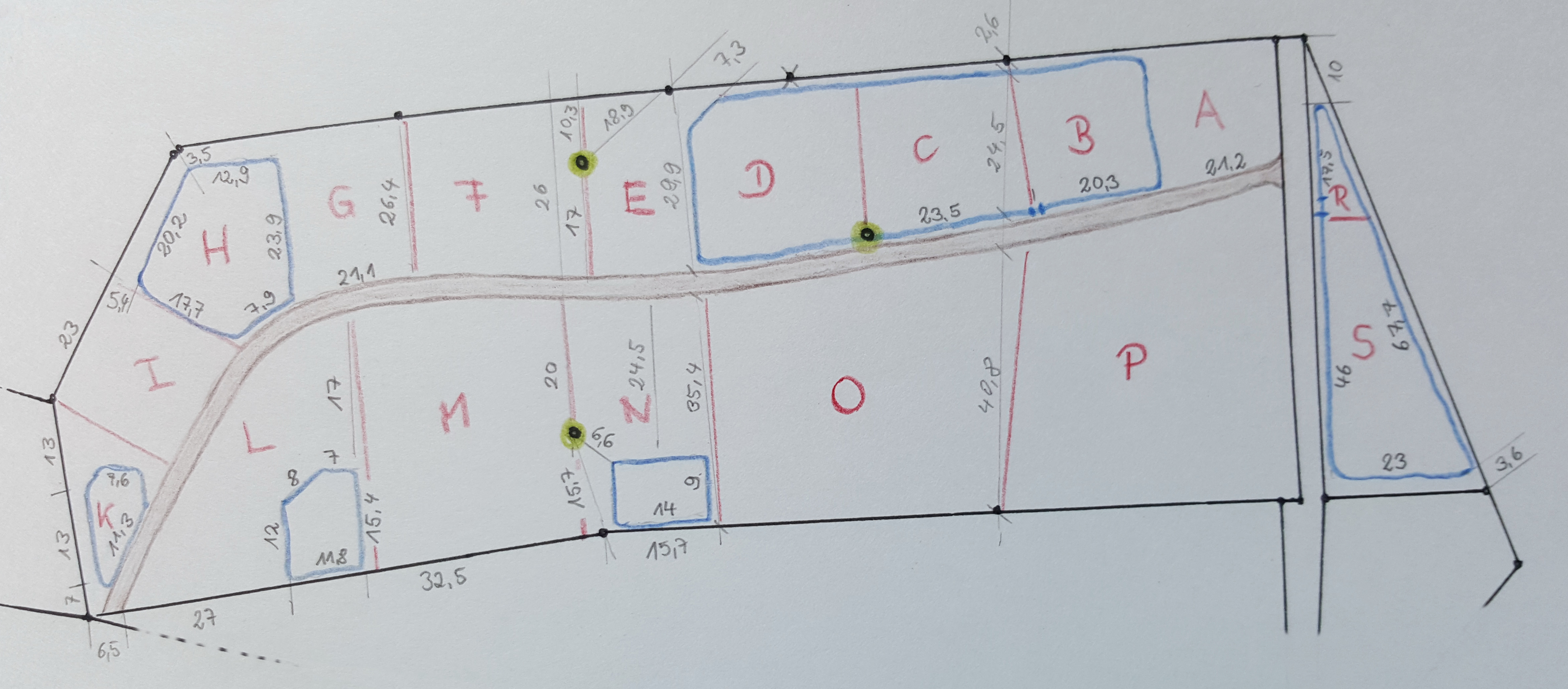Was ist denn Waldumbau?
Unter Waldumbau versteht man im allgemeinen forstwirtschaftliche Maßnahmen zur Umgestaltung des Waldes, insbesondere bezüglich der Baumartenzusammensetzung. Im speziellen meint man bei uns in Bayern den Umbau der hier vorherrschenden Fichten- und Kiefernwälder in Laub- oder Mischwälder.
Ziel dieses Umbaus sind stabile und artenreiche (Misch-) Waldbestände, sodass sich nachfolgende Generationen auch am Wald erfreuen können.
Warum will man denn weg von den Fichten- und Kiefernwälder?
Die Frage ist durchaus berechtigt. Fichten und Kiefern können doch keine schlechten Bäume sein. Immerhin habe sie zusammen einen Anteil von fast 60% in bayrischen Wäldern. Die alten Landwirte und Förster haben sich doch etwas dabei gedacht, als sie die Bäume vor langer Zeit gepflanzt haben. Sie haben sicherlich auch ihre Erfahrungen und Zielvorstellungen bei der Baumauswahl einfliessen lassen. Soll das alles falsch gewesen sein?
In jeder Generation treffen Menschen ihre Entscheidungen anhand der zur Verfügung stehenden Informationen, den äußeren Rahmenbedingungen und den gewünschten Ergebnissen. So war es damals sicherlich richtig, auch auf Fichte und Kiefer zu setzen. Beide liefern schönes Bauholz, wachsen schnell und kommen – im Fall der Kiefer – ausgezeichnet mit den kargen Sandböden zurecht. Hätte ich damals schon gelebt wäre meine Wahl sicherlich auch auf die Kiefer gefallen.
Heinrich Burckhardt lobt 1855 die Kiefer
Bereits 1855 hat Heinrich Burckhardt in seinem Buch „Säen und Pflanzen nach forstlicher Praxis ein Beitrag zur Holzerziehung“ über die Kiefer geschrieben:
„Die Kiefer ist ihrer Verbreitung nach die belagreichste Holzart und besonders wichtig durch ihre Anbaufähigkeit auf den geringsten Bodenclassen neben ihrer Nutzbarkeit, Schnellwüchsigkeit und Bodenverbesserung“
und dann führt er weiter aus:
„Im Übrigen ist die Kiefer das Forstgewächs des großen Sandmeeres im Flachlande und ähnlicher Örtlichkeit da fortfahrend, wo begehrlichere Holzarten nicht mehr bestehen können. Was wären die trockenen Sandgegenden ohne die Kiefer,…“
Es ist also kein Wunder, dass es in unserer vom Sandboden beherrschten Gegend den Kiefern-Steckerleswald gibt.
In meinem Wald wachsen fast ausschließlich Kiefern. Die einzelnen eingeschlichenen Birken und Fichten kann ich an einer Hand abzählen. Wenn also die Kiefer der Wunderbaum auf Sandböden ist, warum will ich dann meinen Wald umbauen?
Roger Sautter beschreibt Kiefern-Katastrophen im Nürnberger Reichswald
Die Antwort findet sich u.a. im Buch „Waldgesellschaften in Bayern – Vegetationskundliche und forstgeschichtliche Darstellung der natürlichen und naturnahen Waldgesellschaften“ von Roger Sautter. Es ist 2003 im WILEY-VCH Verlag, Weinheim erschienen. Der Autor beschreibt eine sehr interessante „Nutzungsgeschichte des Nürnberger Reichswalds“. Die dramatische Übernutzung des Nürnberger Reichswaldes hat im 14. Jahrhundert mit der „Erfindung“ der Nadelwaldsaat durch Peter Stromeir zur „Geburtsstunde der planmäßigen europäischen Forstwirtschaft“ geführt, um die „nachhaltige Belieferung der benötigten Holzmengen sicherzustellen“.
Sautter schreibt:
„Die nächsten acht Jahrzehnte (Anm: ab 1806) waren geprägt von der Rückkehr zur geregelten Forstwirtschaft, wobei insbesondere die Forsteinrichtung von 1840/41 richtungsweisende Wirtschaftsregeln enthielt, die den Wiederaufbau der devastierten (Anm: zerstörten, verwüsteten) Wälder zum Ziel hatten. Die Verwirklichung der hierbei angestrebten höheren Laubholz- und Tannenanteile scheiterte später in nicht seltenen Fällen am Widerstand der Forstrechtler, die um ihre ausschließlich auf weiches Brennholz beschränkten Rechte fürchteten.
Fortwährende Kalamitäten (1836-38: Nonne, Forleule, Fichtenpanner, 1870: Sturmwurf mit anschließendem Rüsselkäfer- und Engerling-Fraß, 1874: Forleule, 1875: Nonne, 1880: Kiefernspanner, 1882: Kiefernspanner) beeinträchtigten die Wirtschaft in nicht unerheblichem Maße, bis sich in den Trockenjahren 1892/93 eine Katastrophe anbahnte, die alles bis dahin Gekannte in den Schatten stellte. Nach dem Trockensommer des Jahres 1892 und dem ungewöhnlich trockenen Frühjahr 1893 entwickelte sich eine Gradation des Kiefernspanners, der bis zum Zusammenbruch der Massenvermehrung im Jahre 1896 9.585 ha, das waren 31,5% der Reichswaldfläche zum Opfer gefallen waren. In einer beispiellosen Einschlagskampagne in den Jahren 1895/96 wurden 1.320.000 Erntefestmester Derbholz kahl abgetrieben, die über ein ausgeklügeltes Rückeweg- und Waldbahnetz abtransportiert und zur Versteigerung bereit gestellt wurden. Hauptausgangspunkt der Massenvermehrung waren die etwa 50-jährigen Kiefernstangenhölzer auf den ärmsten Diluvialstandorten im Westteil des Lorenzer Waldes, die aus den Aufforstungen der Raupenfraßflächen der letzten Großkalamität der Jahre 1836-38 hervorgegangen waren.
Den damals tätigen Forstleuten blieben die Ursachen für diese verherrenden Naturkatastrophen nicht verborgen, die seit Peter Stromeirs Zeiten ihren Ausgang wiederholt von den großflächigen, gleichaltrigen Kiefern-Kunstforsten nahmen, deren Standorte zudem durch Jahrhunderte lange Misswirtschaft stark in Mitleidenschaft gezogen waren. Die hier stockenden Krüppel-Kiefernbestände erwiesen sich als wesentlich anfälliger für tierische und pflanzliche Schädlinge als Mischwälder auf besseren, weniger devastierten Böden.
Anmerkung: Kiefern-Reinkulturen sind anfällig für Schädlinge!
Als Konsequenz aus diesen Erfahrungen setzte man sich einen ertragreichen Kiefern-Fichten-Wald mit Laubholzbeimischung zum Ziel, den man mit Kiefern-Fichten(-Birken)-Saaten und späteren Laubholzvoranbauten (Eiche, Buche, Linde und Robinie) zu erreichen suchte.
Die weiteren Aufbauarbeiten wurden wiederum durch die erheblichen Übernutzungen der beiden Weltkriege um Jahrzehnte zurückgeworfen, so dass sich die Bayerische Forstverwaltung nach dem Zweiten Weltkrieg erneut einer trostlosen Ausgangslage gegenübersah, die von großen Kahlflächen und gleichaltrigen, eintönigen Kiefernstangenhölzern, dem so genannten Steckeleswald bestimmt war.
So wurden zum wiederholten Male in der 600-jährigen Forstgeschichte des Reichswaldes die Verwirklichung anspruchsvoller waldbaulicher Ziele in Angriff genommen, die dieses Mal allerdings unter wesentlich günstigeren gesellschaftlichen Rahmenbedingugnen erfolgen konnte.
Für die auf den Kahlflächen angelegten Kulturen prägte man den Begriff Buntmischung, womit eine Laubholz-Buntbeimischung zur Kiefer gemeint war. Das Laubholz (Eiche, Hainbuche, Linde, Spitzahorn, Ulme u.a.) wurde hierbei, ungeachtet der biotischen und abiotischen Gefahren (Spätfröste, Graswuchs, Trockenheit, Nässe etc.), gleichzeitig mit der Kiefer ausgebracht. Mit ungewöhnlich hohen Pflanzenzahlen (bis zu 50.000 pro Hektar), inniger Mischung auf ganzer Fläche und Beteiligung vorwüchsiger Hilfsbaumarten wie Roterle, Grauerle, Birke und Vogelbeere sowie der Anlage von Schutz- und Beisaaten aus Waldstaudenroggen, Hafer und Lupine versuchte man den Erfolg herbeizuführen. Gute Eichelmasten um das Jahr 1949 erlaubten eine großzügige Betiligung der Sieleiche, so dass von 1948 bis 1959 im Reichswald über eine Million (!) kg Stieleichenln ausgesät wurden. Die in den Fünfziger und Sechziger Jahren verwendete, aus Nordamerika eingeführte Roteiche erwies sich später wegen ihres undudsamen Wuchsverhaltens als weniger gut geeignet, während sich die Hainbuche im Unter- und Zwischenstand der heranwachsenden Kiefern- und Eichenbestände hervorragend bewährte.
Trotz mancher, z.T. empfindlicher Rückschläge – alljährliche Spätfröste vernichteten z.B die 3,4 Millionen eingesetzten Robinien fast vollständig – können die in der Nachkriegszeit eingeleiteten Kulturmaßnahmen im Rückblick als Erfolg gewertet werden.“
Meine Motivation für den Wald-Umbau
Lange Rede, kurzer Sinn: Ein Kiefern-Mischwald ist schöner und stabiler als eine Kiefern-Monokultur und in Anbetracht der Risiko-Minimierung bzgl. Kalamitäten auf lange Sicht auch wirtschaflicher. Außerdem macht es mir Spaß!